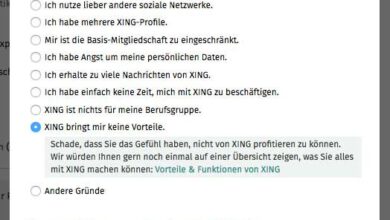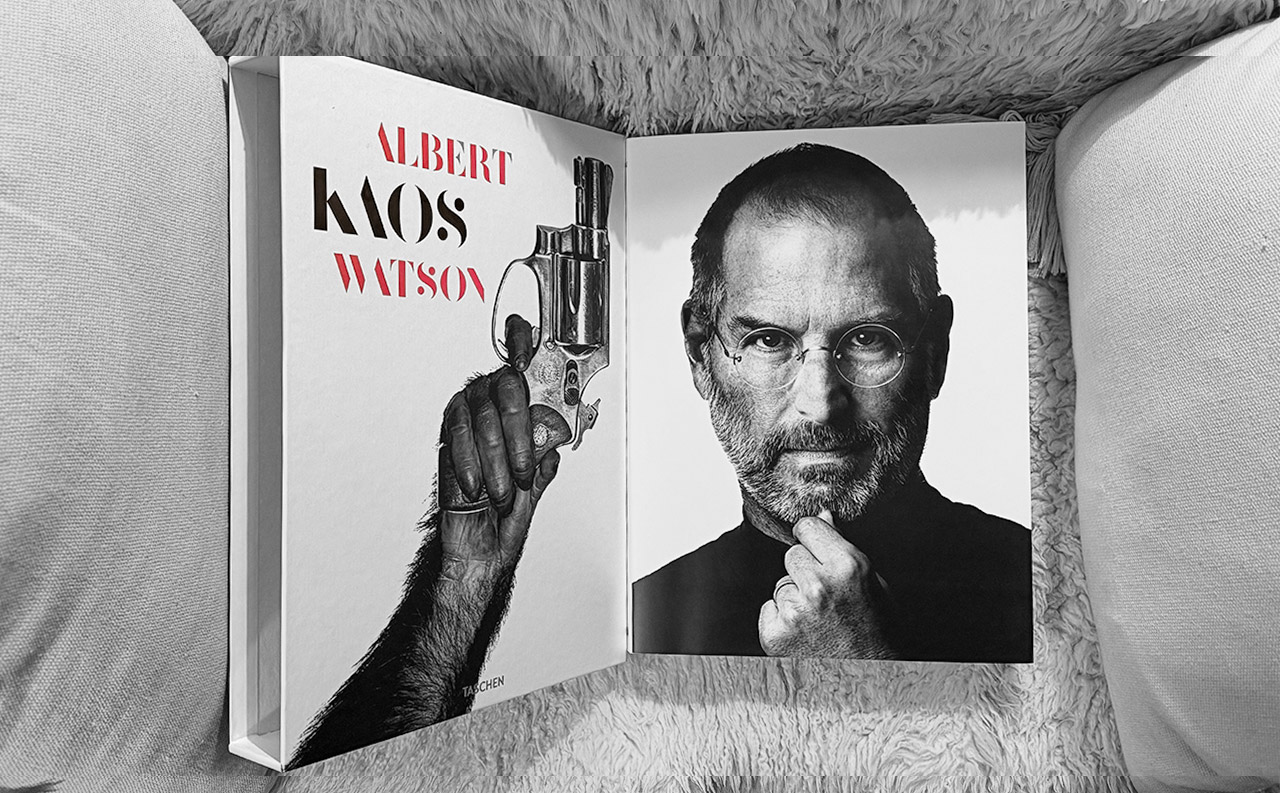Was sind eigentlich Memes?
Nicht das, woran Sie als naturgemäß Internet-affiner Leser wahrscheinlich denken. Als Richard Dawkins den Begriff Meme erfand, hatte er etwas anderes im Sinn.
Wenn heutzutage – und insbesondere in den sozialen Netzen – von Memes die Rede ist, sind durchweg Posts gemeint, in denen bekannte Bilder mit jeweils neuen Texten versehen sind – es handelt sich um ein Witz-Schema, das zu jedem aktuellen Anlass aktualisiert werden kann.

Im Woman yelling at a cat-Meme beispielsweise geht es stets um jemanden, der sich aufregt, und um die konsternierte oder gleichgültige Reaktion desjenigen, dem die Aufregung gilt. Dieses Meme wurde am 1. Mai 2019 erstmals verwendet und ist bis heute populär.
Wenn Sie mit diesem Wissen über Memes philosophische oder kulturwissenschaftliche Texte lesen, werden Sie sich allerdings wundern, weil darin oft dasselbe Wort verwendet wird, aber etwas (fast) ganz anderes damit gemeint ist. Mir fiel das jüngst noch einmal bei der Lektüre von Daniel C. Dennetts From Bacteria to Bach and Back – The Evolution of Minds auf (das es auch in einer deutschen Übersetzung gibt).
Der Begriff Meme wurde vom britischen Biologen Richard Dawkins in seinem 1976 erschienenen Buch The Selfish Gene (Das egoistische Gen) geprägt. Der Gleichklang von Gene und Meme (beziehungsweise von Gen und Mem, wie man im Deutschen eigentlich sagen müsste) war beabsichtigt, denn Dawkins’ Memes funktionieren ähnlich wie die Gene in den Erbanlagen der Lebewesen, nur dass sie sich nicht biologisch, sondern auf kulturellem Wege verbreiten. Dawkins geht davon aus, dass es neben der biologischen eine kulturelle Evolution gibt, und die Einheiten, die sich in der kulturellen Evolution vermehren und verbreiten, sind eben die Memes. Ein einfaches Beispiel für solche Einheiten – auf das Dawkins selbst allerdings nicht ausdrücklich eingegangen ist – sind Wörter.
Jeder von uns kann ein neues Wort erfinden und es selbst verwenden, aber in den meisten Fällen wird es kaum von anderen aufgegriffen und stirbt schließlich aus. Nur wenige Wortprägungen sind erfolgreich; wer sie hört oder liest, fängt an, sie selbst zu verwenden, und je mehr Menschen ein Wort in ihren aktiven Wortschatz aufnehmen, desto größer ist dessen Chance, für längere Zeit zu überleben. Zwischen Wörtern für dieselbe Sache kann es auch Konkurrenzsituationen geben, in der manchmal das eine Wort das andere verdrängt. Vor einigen Jahren sind manche Autoren auf die Idee verfallen, die englische Bezeichnung für ein Vorbild, nämlich „role model“, wortwörtlich als „Rollenmodell“ ins Deutsche zu übersetzen. Dafür gab es eigentlich keinen Anlass, da es ja bereits ein deutsches Wort gibt und „Vorbild“ sogar kürzer als das englische „role model“ (und erst recht das eingedeutschte „Rollenmodell“) ist, und bislang hat sich „Rollenmodell“ auch noch nicht durchsetzen können.
Zu den Memes gehören auch Sprichwörter, Redensarten, Melodien, Rituale, Kleidermoden, Rezepte – jede besondere Art und Weise, in der wir irgendetwas tun, und die von anderen übernommen und nachgeahmt wird und sich so verbreitet. Das können ganz banale Alltagshandlungen sein, wie die Art, wie wir ein Frühstücksei köpfen, oder wie herum wir die Klopapierrolle aufhängen. Um ein Meme handelt es sich auch, wenn Kinder am 31. Oktober verkleidet von Haus zu Haus gehen und Süßigkeiten fordern. In Norddeutschland hat dieser Heischebrauch (das ist der volkskundliche Fachbegriff dafür) einen anderen verdrängt. Das Rummelpottlaufen am 31. Dezember funktionierte früher ganz ähnlich, konnte sich aber nicht gegen Halloween behaupten: In einem Jahr bettelten die Nachbarskinder zweimal, im Oktober und im Dezember, und in den Folgejahren nur noch zu Halloween. Wie ein Virus hatte Halloween mit irischen Auswanderern als Wirten die USA erobert und dank der Massenmedien schließlich auch Europa. Das Rummelpottlaufen war ausgestorben – aber nicht so ganz: Ähnlich wie Europäer und Asiaten noch immer Erbgut des eigentlich ausgestorbenen Neandertalers in sich tragen, haben manche zum Rummelpott-Brauchtum gehörige Lieder überlebt und werden von norddeutschen Kindern nun an Halloween gesungen. (Überhaupt steht uns in den nächsten Wochen noch eine Kette von Memes bevor: Der Adventskranz und der Adventskalender – beide wurden in meiner Heimatstadt Hamburg erfunden und haben sich bis heute weit darüber hinaus verbreitet –, zu Nikolaus mit Süßigkeiten gefüllte Kinderstiefel, der Weihnachtsbaum, noch mehr Geschenke, ein Feuerwerk zu Silvester – aber dann ist erst einmal Ruhe, denn das Befana-Meme (6. Januar) hat die Grenzen Italiens noch immer nicht überwunden.)
Das Konzept der Memes wird von manchen Wissenschaftlern und Philosophen kritisiert, auch weil Dawkins die Verbreitung von Memes mit der von Viren verglichen hat. Bei Viren denkt man ja erst einmal an Krankheitserreger. Tatsächlich tun uns die meisten Viren gar nichts, und einige von ihnen sind wohl sogar nützlich. Memes sind in der Regel nützlich und andernfalls meist harmlos, aber es gibt auch schädliche, sogar tödliche Memes. In islamistischen Kreisen hat sich vor Jahren ein Meme zu verbreiten begonnen, es sei eine gute Idee, sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen und dabei möglichst viele „Ungläubige“ umzubringen. Dieses Meme bringt seinen Wirt um, kann sich aber dennoch verbreiten. Anders als die Gene reproduzieren sich Memes als Information, die über Medien verbreitet wird.
Man stellt sich die kulturelle Entwicklung meist so vor, dass Menschen etwas tun, weil sie gute Gründe dafür haben. Ob man beim Bewährten bleibt oder etwas Neues ausprobiert – in beiden Fällen nehmen wir gewöhnlich an, dass man weiß, was man tut. Zwar wird das oft genug so sein, aber die Memetik zeigt, dass eine positive Weiterentwicklung nicht immer vernunftgemäße Gründe erfordert. Man probiert etwas aus einer Laune heraus aus, oder weil man improvisieren muss, und wenn das zur eigenen Überraschung eine Verbesserung bringt, bleibt man dabei und erzählt anderen davon; andernfalls wird man diese Variante in der Zukunft vermeiden. Wenn ich nach einem Rezept koche und mir eine darin vorgeschriebene Zutat fehlt, werde ich nach Gefühl einen verfügbaren Ersatz wählen, und ich muss kein Profikoch oder Ernährungsphysiologe sein, um dabei auch als sprichwörtliches blindes Huhn gelegentlich eine glückliche Entdeckung zu machen. Vermeintlich gute Gründe können sogar hinderlich sein: Daniel Dennett (s.o.) erwähnt als Beispiel Seefahrer, die davon überzeugt sind, dass man nicht gegen den Wind segeln könne, und es dieser Logik folgend gar nicht erst versuchen. Daher entdecken sie auch nicht die Technik des Kreuzens (wiederum ein Meme), die es dennoch möglich macht.
Wenn die biologische Evolution als survival of the fittest beschrieben wird, ist mit survival nicht gemeint, dass man möglichst alt wird, sondern dass man eine große Nachkommenschaft hat. Die Nachkommen von Memes aber sind Kopien ihrer Information, und die kann sich auch verbreiten, wenn ihr Wirt ohne Nachkommen stirbt. Die kulturelle Evolution tendiert tatsächlich nicht dazu, die Anpassung (fitness) im Sinne von survival of the fittest zu verbessern. Nicht selten ist das Gegenteil wahr, denn beispielsweise reduziert eine akademische Ausbildung statistisch die Zahl der Kinder, die man in die Welt setzt. (Wobei mir einfällt: Das DOCMA-Team scheint bislang auch mehr Ehrgeiz in die Verbreitung von Informationen als in die biologische Reproduktion zu setzen, und ich gebe da selbst kein gutes Beispiel ab.)
Aber wo bleiben bei all dem nun die Memes, wie man sie aus den sozialen Medien kennt? Sie sind zwar ebenfalls Memes in dem Sinne, in dem Dawkins das Wort verstanden wissen wollte, aber nur ein sehr spezieller Spezialfall eines allgemeineren Phänomens, mit dem wir auch außerhalb des Internets ständig zu tun haben. Und ich zumindest finde das interessanter als die doch mit der Zeit ermüdenden Internet-Memes.