Mein Rückblick auf 1968

Die deutschen Medien erinnern in diesem Jahr 2018 immer wieder daran, dass das symbolträchtige 1968 inzwischen ein glattes halbes Jahrhundert zurückliegt. Doc Baumann nimmt ein Fernsehinterview mit ihm, das in der kommenden Woche gesendet wird, zum Anlass, seine eigenen Erinnerungen an jene Zeit zu sortieren. So ist „Mein Rückblick auf 1968“ ein Text über Aufbruch und Hoffnung – aber auch über Scheitern und Selbstkritik.
Wie unfassbar weit zurück geschichtliche Ereignisse zu liegen scheinen, die man selbst nicht erlebt hat, wurde mir 2003 klar. Da saß ich mit einer Tante zusammen; auch ihre Tochter und Enkelin waren zu Besuch. Die Enkelin bereitete sich gerade auf das Abitur vor und erzählte, dass ihr Projektthema „1968“ sei – Studentenproteste, Demonstrationen gegen Vietnam-Krieg und Notstandsgesetze, das Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke … „Ja“, sagte ich, „da war ich damals auch mit dabei.“
Die junge Dame konnte es kaum fassen. Ein echter Zeitzeuge! Sie fragte mir Löcher in den Bauch. Viel wichtiger für mich selbst waren aber meine Überlegungen später auf dem Heimweg. Da wurde mir plötzlich klar, dass 1968 damals 35 Jahre zurücklag – derselbe zeitliche Abstand, der 1968 von 1933 trennte, dem Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung. Wie unendlich weit hatte dieses verhängnisvolle Schicksalsjahr damals 1968 für mich in der Vergangenheit gelegen. Und mit derselben Distanz blickte jetzt die Schülerin auf jene 68er-Ära zurück, die ihr so fern und fremd erscheinen musste, und die mich so stark geprägt hatte und mir noch immer so gegenwärtig war.
Mein Rückblick auf 1968: Wie alles anfing
1968 war für mich auch das Jahr des Abiturs. Das bedeutete, neben dem Büffeln für die im Frühsommer angesetzten Prüfungen eigentlich wenig Zeit für etwas anderes zu haben. Von den politischen Entwicklungen bekam man im damals abgelegenen Kassel – nur wenige Kilometer von der „Zonengrenze“ gelegen – nur durch die Medien etwas mit: Studentenproteste und Demonstrationen in den großen deutschen Universitätsstädten, in Frankreich und in den USA. Verstörende Bilder vom Krieg in Vietnam.
Noch 1967 hatte ich im Sozialkundeunterricht diesen Krieg verteidigt, weil ich der Meinung gewesen war, diese Bereitschaft der Amerikaner zum Kampf gegen die Kommunisten beweise, dass sie auch bereit sein würden, uns selbst zu schützen, wenn die Russen mit den Truppen des Warschauer Pakts über die nahegelegene Grenze zur „DDR“ vorstoßen würden.
Allerdings lernte ich schnell dazu. Noch im selben Jahr unternahm unsere Klasse in den Sommerferien eine Fahrt nach Frankreich, um dort deutsche Kriegsgräber zu pflegen. Bei einem hochoffiziellen Besuch des Vorstands des „Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge“ in unserem Zeltlager störte ich die Harmonie der Festveranstaltung durch die peinliche Frage, wieso sich eine Organisation, die sich der Aufarbeitung der schrecklichen Folgen vergangener Kriege zur Aufgabe gemacht hat, kein Wort zu den Gräueln des Krieges in Vietnam abringen könne.
1968, im Jahr darauf, studierte ich bereits eifrig das kleine rote Büchlein mit den Worten des Vorsitzenden Mao Tse-tung. Keine Ahnung, was mir diese oft platten und belanglosen Sprüche, Musterbeispiele für Brachialdialektik, damals brachten. Aber allein dieses Büchlein in der Brusttasche herumzutragen verschaffte mir das gute Gefühl, auf der „richtigen Seite“ zu stehen.
Am Ostersamstag, den 14. April 1968, nahm ich an meiner ersten Demonstration teil. Drei Tage vorher war Rudi Dutschke, einer der führenden Köpfe des Berliner SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) bei einem Attentat von einem Rechtsradikalen lebensgefährlich verletzt worden. Die Hauptschuld daran sahen wir – mit guten Gründen – bei der Springer-Presse, bei Bild-Zeitung und Co., die in den Monaten zuvor die Stimmung für diese Gewalttat durch entsprechende Hetzparolen angeheizt hatten.
Die Stimmung bei dieser Demonstration war völlig friedlich. Damals konnte man mit den Polizisten noch reden, und die teilten ihre persönliche, oft genug zustimmende Meinung mit. Wir standen erkennbar Menschen gegenüber, und niemand wäre auf die Idee gekommen, gegen sie Gewalt anzuwenden. Bei den martialischen Gestalten von heute, die aussehen wie geklonte, aus einem Star-Wars-Film entlaufene Halbroboter, dürfte diese Assoziation schwerer fallen.
Mein Rückblick auf 1968: Gewalt
Ich kann nur für mich selbst sprechen. Gewalt habe ich bei diesen Veranstaltungen selten erlebt. Allerdings bei der übernächsten Demonstration in Kassel schon, am 29. Mai. Einen Tag später sollten die Notstandsgesetze im Parlament – damals noch in Bonn – verabschiedet werden. Und genau an diesem Tag traf sich die Spitze der Bundeswehr – die in eben jenem Notstandsfall gegen die Bevölkerung eingesetzt werden sollte – in Kassel zu einer Kommandeurstagung. Wir forderten auf Transparenten und in Sprechchören eine Stellungnahme der Offiziere zu ihrem vorgesehenen Einsatz gegen Zivilisten. Eine Antwort bekamen wir nicht. Stattdessen wurden Sitzblockaden zunehmend gewaltsam von Polizisten und Feldjägern aufgelöst. Zumindest versuchten sie es. Doch die Blockade war erfolgreich. Busse kamen weder vor noch zurück. Der Bundesverteidigungsminister musste im Hubschrauber eingeflogen werden.
Eine Teilnahme an dieser Demonstration war problematisch, denn sie fiel mitten ins Abitur und hätte unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen können. Hier kam mir der Zufall zu Hilfe: Morgens hatte meine Klasse Sport-Abitur auf einem zentralen Sportplatz in Kassel. Als wir am Vormittag pünktlich zur großen Pause wieder an der Schule eintrafen, war das Tor verschlossen und wurde von Direktor und Lehrern bewacht, die verhindern wollten, dass Schüler/innen das Gelände verlassen und an der Demonstration gegen die Notstandsgesetze teilnehmen. So konnten mein Freund und ich uns breit grinsend umdrehen und davonmarschieren … Repressionen gab es im Anschluss keine, schließlich hatten sie uns ja nicht reingelassen.
Selbst Gewalt angewendet habe ich nur einmal – fast. Allerdings nicht gegen einen Polizisten, sondern gegen ein Mitdemonstranten. Bei einer Demonstration in Düsseldorf, wo ich 1969 studierte, besprühte der das Auto einer Fahrerin, die warten musste, bis der Demonstrationszug vorbeigezogen war, mit linken Symbolen. Ich nahm ihm die Sprühdose ab und musste mich sehr beherrschen, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen. Ob das seine Vorstellung davon war, der Bevölkerung die eigenen Ziele nahezubringen?
Gewalt gab es im selben Jahr auch in Kassel, wo im September der Parteitag der NPD stattfand. Einer der führenden Kasseler Linken zur damaligen Zeit (der später den Berliner Aufbau-Verlag gründete), wurde vom Leiter des Ordnungsdienstes der rechtsextremen Partei angeschossen. Entsprechend aufgeladen war die darauf folgende Demonstration.
Mein Rückblick auf 1968: Wissen ist Macht
1969 kam ich aus Düsseldorf nach Kassel zurück, um dort mein Studium an der Kunsthochschule aufzunehmen – eine Uni gab es damals noch nicht in der Stadt, so dass die Kunst-Studenten und -Studentinnen dort fast automatisch die Leitfiguren linker Politik in Kassel wurden. Obwohl sie nur wenige Jahre älter waren als ich, schaute ich bewundernd zu ihnen auf.
Ich zog bald in eine Wohngemeinschaft. Die war zwar eindeutig links ausgerichtet, aber dennoch meilenweit von dem entfernt, was sich die braven Bürger nach den Medienberichten über die Berliner Kommune 1 unter dieser Lebensform vorstellten.
Da zu der Wohnung ein ehemaliger Glaser-Laden gehörte, nutzen wir die Gelegenheit, dort einen linken Buchladen einzurichten, den wir „Roter Punkt Politbuch-Kollektiv“ nannten. Der führte all die kritische Literatur, die der Kasseler Buchhandel nicht anbot, von den Werken von Marx und Engels aus dem Ost-Berliner Dietz-Verlag, Lenin, Trotzki, Mao, bis hin zu Büchern fürs Studium, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Kinderladen-Bewegung, Kunst des sozialistischen Realismus, Literatur der beginnenden Frauen-Emanzipation usw.
Kennzeichnend für die damalige Zeit ist, dass diese Tätigkeit in unserem Buchladen von der Hochschule offiziell als Projektgruppenarbeit für unser Studium angerechnet wurde. Heute unvorstellbar! Und doch so sinnvoll – dort habe ich für mein weiteres Berufsleben sicherlich ebenso viel gelernt wie in den Vorlesungen und Seminaren. In den Hochschulgremien – in denen ich acht Semester lang als studentischer Vertreter arbeitete – hatten die Studenten Halbparität, also 50% der Sitze. Und es funktionierte!
Ich konnte mich allerdings nie dazu durchringen, Mitglied einer der vielen linken Gruppen zu werden, die es damals gab. Die beschäftigten sich aus meiner Sicht zu sehr mit allem Trennenden statt mit Verbindenden. Ich versuchte dagegen immer eher, die Leute an einen Tisch zu kriegen.
Das Foto oben zeigt mich damals ganz rechts im Hörsaal der Kunsthochschule; der halb verdeckte Mann mit dem Kinnbart am linken Rand war mein Kunstgeschichts-Professor. Den brachte ich mit kritischen Anmerkungen immer wieder auf, und als er eine Vorlesung zum Verhältnis von nationalsozialistischer und stalinistischer Malerei ankündigte und ich Befürchtungen äußerte, aus phänomenologischen Übereinstimmungen könnten politische Schlüsse gezogen werden, brüllte er mich an, wenn ich alles besser wisse, solle ich die Vorlesung doch gleich selbst halten. Diesem kaum ernst gemeinten Vorschlag stimmte ich spontan zu, so dass er keinen Rückzieher mehr machen konnte.
Meine Vorlesung wurde ein großer Erfolg. Nach außen hin. Ich selbst dagegen lernte bei ihrer Vorbereitung, dass die Ähnlichkeiten zwischen stalinistischer und nationalsozialistischer Malerei eben nicht nur phänomenologischer Art waren, sondern auch andere, unerfreuliche Parallelen aufwiesen. Das sagte ich in meiner Vorlesung allerdings nicht – wie hätte ich schließlich dagestanden? (Nun, vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich es damals erwartet hatte.)
Nach Abschluss meines Studiums hat sich das Verhältnis zu diesem Professor übrigens erheblich verbessert und mündete in eine freundschaftliche Beziehung. Im Rückblick sieht man vieles milder, von beiden Seiten aus.

Ich habe in jenen Jahren sehr viel gelernt, und mein Rückblick auf 1968 erhält auch die Erinnerung an ein Gespräch mit einem – inzwischen verstorbenen – Freund an einer Straßenbahnhaltestelle über unsere weiteren Perspektiven. Ich sagte damals: „Wir können es nur dann schaffen, etwas zu verändern, wenn wir bei dem, was wir tun, besser sind als die anderen.“
Was das bedeutet, musste ich allerdings erst mühsam lernen. Denn in jenen Jahren schien ich zu glauben, das letzte, endgültig überzeugende Argument in einer Diskussion sei, aus dem Kopf das schlagende Zitat von Marx oder Engels hersagen zu können, das die eigene Position stützt. Ende.
Allerdings lernte ich auch bald, das das kein Kriterium für Wahrheit ist, sondern nichts anderes als der Glaube an die Macht der Autoritäten, der schon die scholastische Philosophie des Mittelalters hatte versteinern lassen.
Als 1973 die Kräfteverhältnisse in unserem Buchladen immer mehr von einer politischen Gruppe dominiert wurden, die dort nur noch eine Propagandaplattform für eigene Positionen verwirklichen wollte und alles nicht dazu Passende aus den Regalen verbannte, nahm ich meinen Abschied: „Wenn die gesammelten Werke von Hegel gehen müssen, dann gehe ich gleich mit.“
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ich mein späteres Berufsverbotsverfahren (ja, das gab’s damals noch, dank Willy Brandt) ausgerechnet der vermeintlichen Mitgliedschaft in eben jener Gruppe zu verdanken hatte. Dabei hatten die mich, lange zuvor, nur mal gefragt, ob ich auf ihrer studentischen Liste für den Hochschulrat kandidieren würde – sie hätten einfach nicht genug Leute und ich stünde ganz am Ende und würde garantiert nicht nominiert. Ich sagte großzügig zu. Aber mit einer so billigen Wahrheit kann man sich ja nicht aus einem Anhörungsverfahren winden. Na ja, das Verfahren endete trotzdem zu meinen Gunsten.
Mein Rückblick auf 1968: Hoffnungen und Selbstkritik
Natürlich gehörte es damals in unserer Welt zum guten Ton, als Endziel der Revolution die Diktatur des Proletariats vor Augen zu haben. Das hatten die marxistisch-leninistischen Klassiker so geschrieben, und die mussten es schließlich wissen.
Auch ich hatte damals stets „die Revolution“ vor Augen. Aber ich dachte keinen Augenblick darüber nach, wie diese Revolution ablaufen sollte und was konkret zu geschehen hatte, und was ich dabei tun könnte. Ich sah nur den ersehnten Endzustand.
Und der hatte, ehrlich gesagt, gar nichts mit einer Diktatur des Proletariats zu tun, sondern war eher eine sehr vage Vorstellung von der Fortsetzung all dessen, was ich kannte – mit dem großen Unterschied, dass ich von einer Welt ohne Ungerechtigkeit, Krieg, Gewalt und Dummheit träumte. Quasi einem paradiesischen Zustand. (Da ich mich seit vielen Jahrzehnten – obwohl Atheist – mit theologischen Fragen und Kirchengeschichte befasse, weiß ich heute, dass sich diese Hoffnung nicht allzu stark von jener der frühen Christen unterscheidet, die ungefähr dasselbe als das kommende Reich Gottes bezeichneten – und noch zu ihren Lebzeiten erwarteten.)
Bei dem TV-Interview zu 1968 wurde ich auch gefragt, ob ich in unserer heutigen Gesellschaft noch Auswirkungen jener Jahre nach 1968 sehe. Ich sehe sie, aber auch viele Rückschläge. Bemerkenswerterweise scheinen jedoch die politischen Gegner von rechts diese Erfolge noch weit deutlicher zu sehen als ich, sonst würden sie nicht immer wieder wutschnaubend darauf verweisen, dass diese Nachwirkungen bis in unsere Gegenwart reichen. (Meuthen, AfD, etwa, spricht von „einem rot-grün versifften 68er Deutschland, von dem wir die Nase voll haben“.)
Dabei glaube ich, dass kaum jemand von denen, die sich heute als konservativ oder dezidiert rechts bezeichnen, noch freiwillig in einem spießbürgerlichen Mief wie dem von 1968 leben möchte. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Wie viele Politiker/innen des rechten Lagers, von CDU bis AfD, können heute problemlos offen ihre Homosexualität leben. Hätte es die 68er nicht gegeben, sondern nur ihre eigenen Gesinnungsgenossen, existierte der Paragraf 175 noch heute, und sie müssten jederzeit damit rechnen, dass nicht nur ihre politische Karriere schlagartig zu Ende wäre, sondern sie aufgrund ihrer sexuellen Abweichungen zudem im Gefängnis landen würden. Es ist heuchlerisch, solche (es gibt viele andere) Freiheiten als selbstverständlich in Anspruch zu nehmen und zugleich gegen jene zu wettern, die sie – auch für sie – erst erkämpft haben.
Selbstverständlich haben die 68er auch jede Menge Fehler gemacht. Kleingeistiger Dogmatismus, bei Teilen – wie der RAF –, ein Abrutschen in die Gewalt, Sektierertum, Besserwisserei, Autoritätsgläubigkeit (ausrechnet bei den Antiautoritären der APO – wobei mir die Sponti-Gegenposition genauso wenig sympathisch war. Die vermeintliche Identifikation mit „dem Proletariat“ war eine elitäre Illusion und ging weit an der Realität vorbei.
Aber ist 1968 und seine gesellschaftlichen Folgen deswegen zu bedauern? Ich jedenfalls bedaure es nicht. Ich stehe nicht zu allem, was ich damals gedacht und vertreten habe. Aber da das Prinzip der Selbstkritik für mich nie bedeutet hat, nach Abweichungen von der offiziellen Parteilinie reuevoll wieder auf Kurs zu kommen, kann ich trotz der genannten Fehlentwicklungen sagen: Trotz gelegentlich falscher Wege und Fehleinschätzungen, meine Träume von einer besseren Zukunft – von Gerechtigkeit, Frieden, einem Ende von Unterdrückung und Ausbeutung, dem Sieg des Wissens über die Dummheit – sind im Grundsatz noch dieselben wie damals; ich beklage alles, was diese Entwicklung behindert und freue mich über jeden kleinen Schritt, der in diese Richtung führt.
PS: Das Interview sendet hr3 in der Hessenschau am Donnerstag, den 29. März, ab 19:30 Uhr. „Mein Rückblick auf 1968“ ist übrigens mein 168. Beitrag beim DOCMA-Blog … und ich bin in diesem Jahr 68 geworden.












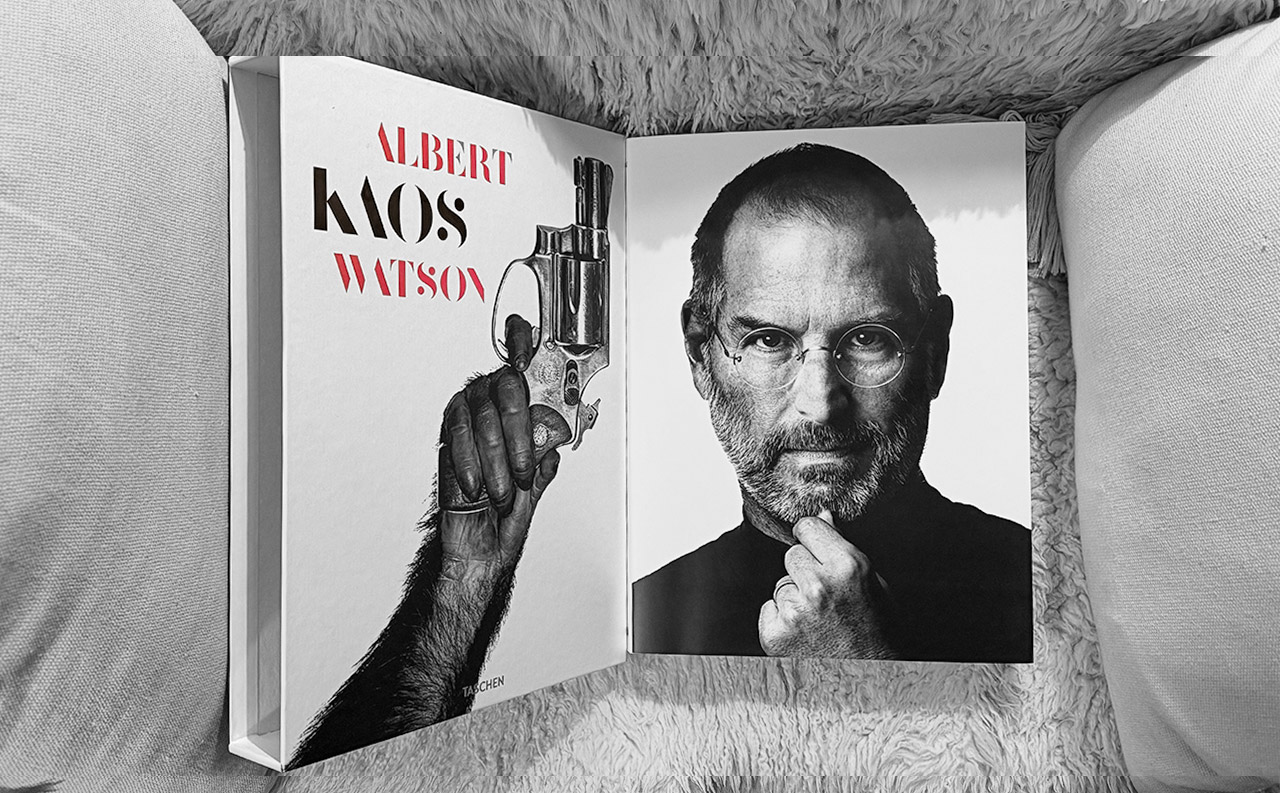
Toller Rückblick ! Daumen hoch! Durchhalten ! Weiter so!
Beim Barte des Propheten:
Danke für diesen Rückblick, lieber Doc Baumann…und Gratulation nachträglich zum 68. (der Bart macht Sie allerdings älter).
Apropos Frisur:
An den regelmäßigen Kommentar eines unserer Lehrer zu unserem Erscheinungsbild (Bart und Zottelmähne waren angesagt) erinnere ich mich noch sehr gut: „Lange Haare – kurzer Verstand“.