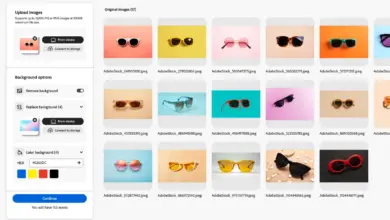Pfeifen und gepfiffen werden
Der englische „Whistleblower“ hat mittlerweile Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden; Alternativen wie „Hinweisgeber“ haben sich nicht durchgesetzt. Mit seinem neuen Tippgeber-Portal will der Hannoveraner Heise-Verlag nun auch in Deutschland die Tugend fördern, illegale oder unmoralische Machenschaften aufzudecken, an denen man nicht mitschuldig werden will.
Der Tote Briefkasten des Heise-Verlags ist nicht der erste seiner Art; vor vier Jahren hatte sch die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit ein Portal für Whistleblower eingerichtet. Ob dieses viel genutzt wurde, ist allerdings unklar. Der Heise-Verlag und das Magazin c’t als sein wohl wichtigstes Produkt haben sich schon bisher recht unerschrocken gezeigt, wenn es um Kritik an großen Firmen (einschließlich potentieller Anzeigenkunden) ging, und man kann den Kollegen zutrauen, dass sie mit ihnen zugespielten Informationen kompetent und verantwortungsvoll umgehen werden.

Der Begriff des Whistleblowers ist alt; in den USA wird er seit 1970 in der heute gängigen Bedeutung gebraucht. Entsprechend dem Bild des britischen Bobbys, der in die Pfeife bläst, um ein Verbrechen anzuzeigen und Verstärkung anzufordern, soll der metaphorische Whistleblower üble Machenschaften öffentlich machen. Der Whistleblower deckt Missstände aufgrund seiner moralischen Überzeugungen und ohne Aussicht auf einen persönlichen Vorteil auf – im Gegensatz zum Verräter, der aus niederen Beweggründen handelt.
Auch wenn sie es verdient hätten, ist es leider nicht so, dass Whistleblower durchweg für ihre Taten belohnt würden. Daniel Ellsberg veröffentlichte 1971 die „Pentagon Papers“, vertrauliche Dokumente über den Vietnamkrieg, die einen desillusionierenden Blick in die Entscheidungszentrale der US-Administration erlaubten (und die mein Bild von der Politik bis heute geprägt haben). Ellsberg wurde wegen Spionage und anderer Straftaten vor Gericht gestellt, was ihm eine Gesamtstrafe von maximal 115 Jahren eingebracht hätte – wäre die Regierung in ihrem Eifer, Ellsberg ins Gefängnis zu bringen, nicht ausgesprochen dilettantisch und illegal vorgegangen, worauf ihn das Gericht überraschend freisprach.

Seit 1989 gibt es in den USA zwar einen „Whistleblower Protection Act“, der aber einen verdienstvollen Whistleblower wie Chelsea Manning nicht vor der Strafverfolgung schützte; Edward Snowden konnte sich nur durch Flucht vor einer drohenden Verhaftung retten. In Deutschland sind bislang alle Versuche (insbesondere der Grünen und der SPD) gescheitert, den Schutz von Whistleblowern im Gesetz zu verankern. Durch das jüngst verabschiedete Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung wurde die Verbreitung widerrechtlich erlangter Informationen sogar noch zusätzlich unter Strafe gestellt – der betreffende Passus, der ursprünglich auf die Weitergabe von Kreditkartendaten und Ähnlichem gemünzt war, ist im Gesetz nun so allgemein gehalten, dass er auch zur Verurteilung von Whistleblowern genutzt werden kann. Die ambivalente Haltung der Bundesregierung zu Wistleblowern zeigte sich darin, dass sie sich einerseits Snowdens Enthüllungen bediente und diese für nützlich erachtete, es andererseits aber ablehnte, Snowden in Deutschland Schutz zu gewähren. Das erinnert an die Caesar zugeschriebene Aussage, er liebe den Verrat, aber hasse den Verräter – nur leistet der Whistleblower anders als der schnöde Verräter einen Dienst an der Allgemeinheit, der noch heute öfter bestraft als belohnt wird. Das musste jüngst auch die russische Läuferin Julija Stepanowa feststellen, die das staatliche Dopingsystem in Russland aufgedeckt hatte, der aber aus fadenscheinigen Gründen die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio verweigert wurde – eine Entscheidung des IOC, die daran zweifeln lässt, dass dieser Institution wirklich etwas an der Aufdeckung von systematischem Doping liegt.
In der aktuellen rechtlichen Situation bleibt Whistleblowern nur, den Schutz der Anonymität zu suchen – und die Zusammenarbeit mit Journalisten, die sich auf den Quellenschutz berufen können, um die Identität von Whistleblowern nicht preisgeben zu müssen. Gleichzeitig sind Journalisten in der Lage, die enthüllten Informationen wirksam in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Negativbeispiel gibt dagegen die Entwicklung der Enthüllungsplattform Wikileaks ab, die aufgrund technischer Fehler oder schlichter Inkompetenz auch ungefilterte Daten veröffentlicht und damit möglicherweise Menschen in Gefahr gebracht hat. Die seriöse Presse kann als zwischengeschaltete Instanz auch solche potentiell verhängnisvollen Folgen von Enthüllungen vermeiden.
Die Trillerpfeife des Bobbys ist nicht die einzige Pfeife, aus der ein sprachliches Bild geworden ist. In der englischsprachigen Presse findet man oft den Begriff der „dog whistle“, wenn von Wahlkampfreden populistischer Politiker die Rede ist. Mit der Hundepfeife, deren hohe Töne nur Hunde hören, ist hier die Verwendung von Schlüsselworten gemeint, mit denen Politiker eine spezielle Klientel ansprechen wollen, ohne andere potentielle Wähler abzuschrecken. Diese Taktik ist auch deutschen Politikern vertraut. Björn Höcke, der Sprecher der AfD in Thüringen, redet beispielsweise gerne von einem „tausendjährigen Deutschland“, was zumindest von Teilen seines Publikums als Verweis auf das „Tausendjährige Reich“ der Nazis verstanden wird. Höcke kann dennoch treuherzig versichern, nur von der deutschen Geschichte seit Ottos des Großen gesprochen zu haben, auch wenn sein an Goebbels erinnernder Stil vermuten lässt, dass die Vieldeutigkeit beabsichtigt ist.
Eine Pfeife, egal welche, ist erst einmal nur laut und schrill. Wer sich davon nicht herumkommandieren lassen will, muss sehr genau prüfen, was der Mann mit der Pfeife einem sagen will. Auch vermeintliches Whistleblowing kann sich als Teil einer Desinformationskampagne herausstellen, und Enthüllungsportale sind nicht davor gefeit, in diesem Sinne missbraucht zu werden. Die Presse kann hier bereits einen wichtigen Beitrag leisten, Informationen zu prüfen und in den richtigen Kontext einzuordnen, aber letztendlich bleibt es die Aufgabe des Lesers, sich durch den Vergleich verschiedener Quellen und den Gebrauch seiner Vernunft ein eigenes Bild zu machen.