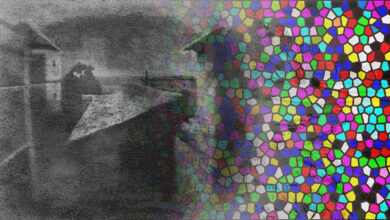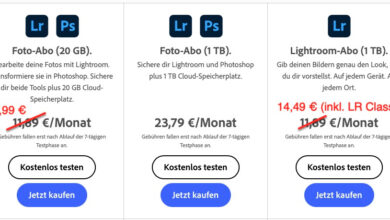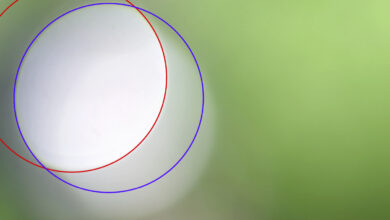Vier Wochen ohne Post
In der Nacht von Montag auf Dienstag ging der Poststreik zu Ende. Die Auswirkungen des Streiks waren ja regional unterschiedlich, aber in meinem Fall bedeutete er, dass ich vier Wochen lang überhaupt keine Post bekam – keine Briefe, keine Pakete, keine Zeitschriften, rein gar nichts. Und das wohlgemerkt nicht irgendwo auf dem platten Land, sondern in der Großstadt Hamburg. Am Dienstag ließ sich der Briefträger tatsächlich zum ersten Mal wieder sehen, wenn auch nur mit einem einzigen Paket – ironischerweise war es dasjenige, das zuletzt auf die Reise gegangen war. Es wird wohl noch etliche Tage dauern, bis die gesamte ausstehende Post zugestellt sein wird.

Ärgerlich sind die Auswirkungen des Streiks auf jeden Fall, wobei sich mein Ärger eher gegen die Post als gegen die Gewerkschaft richtet. Wenn ein Postsprecher erklärt, dass 80 Prozent aller Postsendung mit höchstens einem Tag Verspätung ihren Empfänger erreichten, ich aber wochenlang überhaupt keine Post bekomme, dann fühle ich mich als Kunde nicht ernstgenommen. Kann die Post nicht wenigstens zugeben, dass sie der Streik hart gebeutelt hat? Die Gewerkschaft hat dagegen mein Verständnis, und ich bedaure nur, dass der Streik nicht den erhofften Erfolg hatte: Sein Hauptziel, die Ausgliederung von Teilen der Postzustellung an Tochterunternehmen rückgängig zu machen, die unter dem vereinbarten Tarif zahlen, wurde verfehlt. Die Post ließ sich lediglich auf einen Kündigungsschutz für diejenigen Beschäftigten festlegen, die beim Mutterunternehmen beschäftigt sind. Zwar hält der deutsche Staat noch immer 21 Prozent der Post AG, doch konnte (oder wollte) er nicht verhindern, dass die Post ihre Rendite durch Lohndrückerei steigern will. Dabei geht es dem Unternehmen nicht schlecht; es macht Milliardengewinne und erreicht eine Rendite von mehr als 5 Prozent.
In Situationen wie dieser frage ich mich, was eigentlich aus dem bewährten Rheinischen Kapitalismus geworden ist, wie er die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik geprägt hatte. In meiner Jugend sah das Ritual einer Tarifverhandlung noch vor, dass eine Gewerkschaft Lohnforderungen stellte, die Arbeitgeber daraufhin ein Angebot machten, das deutlich darunter lag, und die beiden Tarifparteien dann in Verhandlungen eintraten, in deren Verlauf es gelegentlich auch zu einem längeren oder kürzeren Streik kam, bis man sich irgendwo in der Mitte zwischen den Maximalpositionen traf. Heutzutage ist es aber fast zur Regel geworden, dass öffentliche – ebenso wie private – Arbeitgeber erst einmal gar kein Angebot machen. Die Folge sind Warnstreiks schon zu Beginn der Tarifauseinandersetzung, bis die Arbeitgeber dann doch ein Angebot machen und die eigentlichen Verhandlungen beginnen können. Worin der Sinn besteht, auf diese Weise Streiks zu provozieren, habe ich nie verstanden. Es geschieht auch immer wieder, dass Unternehmen Umstrukturierungen zu Lasten der Beschäftigten vornehmen, ohne sich vorher mit dem Betriebsrat zusammenzusetzen oder ihn wenigstens von den Plänen zu informieren. Es hat den Anschein, als suchten die Arbeitgeber geradezu die Konfrontation mit den Gewerkschaften. Die Leidtragenden dieser konfrontativen Taktik sind naturgemäß die Kunden, denn man kann ja kaum einen Betrieb bestreiken, ohne dass dessen Kunden davon in Mitleidenschaft gezogen werden.
Es ist auch nicht so, dass es den so agierenden Unternehmen schlecht ginge. Der Post AG geht es trotz der Konkurrenz durch andere Dienste sogar recht gut, auch wenn sich eine ganz ordentliche Rendite noch immer steigern ließe. Die Post hat zwar das Briefporto lange Zeit stabil gehalten (inzwischen erhöht sie es Jahr um Jahr, und zwar stets über die aktuelle Inflationsrate hinaus), dafür aber ihre Dienstleistungen immer weiter verschlechtert. Immer mehr Postfilialen wurden geschlossen und immer mehr Briefkästen abmontiert. War es früher noch üblich, dass Briefkästen zweimal pro Tag geleert wurden und am Sonntag immerhin noch einmal, gibt es heute nur noch eine Leerung und am Sonntag gar keine mehr. Alle Briefkästen in meiner Umgebung werden um 9 Uhr geleert, so dass ein im Laufe des Tages eingeworfener Brief erst am nächsten Tag abgeholt wird. Aus dem Versprechen einer Zustellung „E+1“, also einen Tag nach der Einlieferung, wird so automatisch E+2, selbst wenn ansonsten alles nach Plan verläuft.
Eines meiner Lieblingsbücher ist Thomas Pynchons „The Crying of Lot 49“ (in deutscher Übersetzung als „Die Versteigerung von No. 49“ erschienen). Darin geht es um ein im Untergrund tätiges Postsystem, eine geheime Organisation, die seit der Zeit des Postmonopols von Thurn und Taxis eine Art Rebellenpost unter dem Namen W.A.S.T.E („We Await Silent Tristero’s Empire“ nach ihrem Gründer Tristero) betreibt. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich streiten und der Kunde der leidtragende Dritte ist, muss man das Problem vielleicht mal ganz anders angehen und neue Bündnisse schließen. Könnte man die Postzustellung nicht auf einer neuen Basis organisieren, wenn sich streikende Postzusteller und ihre Kunden zusammentun? Die Situation ist so verfahren, dass wir ganz neue Ideen brauchen; noch längere und noch härtere Streiks können keine Lösung sein.