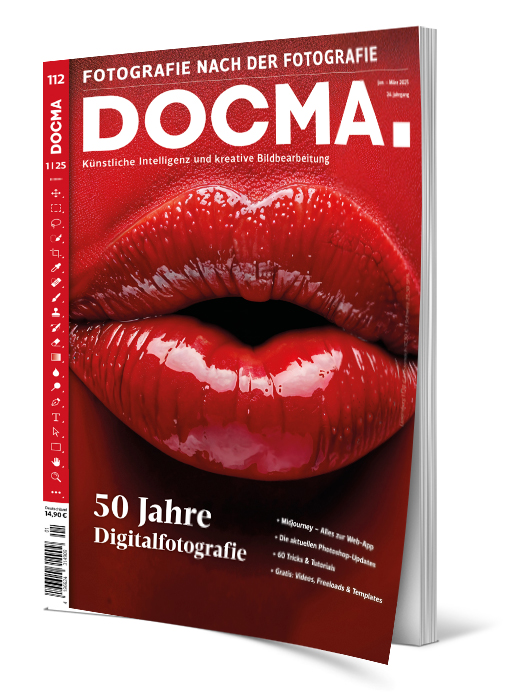Die analogen Wurzeln des Digitalen
So manches, das Jüngere nur von der digitalen Fotografie kennen, hatte eigentlich seinen Ursprung in der analogen Fototechnik. Bildformate beispielsweise, aber auch vieles andere, von Metadaten bis zur Bildbearbeitung.
Der Mensch ist ja geneigt, Dinge einfach hinzunehmen, wenn er sie gar nicht anders kennt. Aber warum beispielsweise ist 36 mm × 24 mm, also das Kleinbild- oder, wie manche sagen, Vollformat, so groß, wie es ist? Warum wird ein halb so großes Bildformat manchmal „Super 35“ und manchmal „Halbformat“ genannt? Warum spricht man von APS-C- und APS-H-Sensoren, obwohl das Filmformate des analogen APS-Systems sind, die gar nicht der Größe der Sensoren entsprechen? Und ist 43,8 mm × 32,9 mm wirklich schon Mittelformat oder nicht doch eher ein groß geratenes Kleinbild?

Fangen wir mit dem Kleinbild an: Wieso gilt es als klein, wenn es doch deutlich größer als APS-C, Micro Four Thirds (MFT) oder die Sensoren in Smartphones ist? Nun gut, das Mittelformat (oder ein Mittelformat, denn es gibt etliche) ist noch größer, aber eben auch bloß mittel – wird die Digitalfotografie denn nie wirklich groß?
Sensoren kann man heutzutage in allen möglichen Größen und Seitenverhältnissen bauen, aber analoge Kameras belichten überwiegend auf Spulen aufgerollte Filmrollen in standardisierten Größen. Die möglichen Bildformate sind daher durch die Höhe der Filmrollen beschränkt, und nur die Breite der Bilder ist variabel. Der Unterschied zwischen Kleinbild und Mittelformat bestand ursprünglich darin, dass Kleinbildkameras Filmmaterial des Typs 135 mit einer Höhe von 35 mm nutzen, Mittelformatkameras dagegen Rollfilm der Typen 120 oder 220, beide mit einer Höhe von 61,5 mm. In Großformatkameras verwendete man Planfilm (oder früher mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichtete Glasplatten) – ein auf das jeweilige Format zugeschnittenes Stück Film für jedes einzelne Bild statt einer Filmrolle, die Platz für mehrere Bilder bot. Die Großformate waren dann so groß, dass man ihre Maße in Zoll statt in Zentimetern oder Millimetern angab.
Zurück zum Kleinbildfilm … Der Film des Typs 135 war eigentlich der 35 mm breite Kinofilm (Filmproduktionen mit kleinem Budget nutzten 16-mm-Film und die Amateure 8 mm), der senkrecht durch die Kamera und später, im Kino, durch den Projektor lief. Die für den präzisen Filmtransport nötigen Reihen von Perforationslöchern links und rechts kosteten viel Platz, so dass maximal 24,89 mm für die Bildbreite übrig bleiben, wenn man auf die optische Aufzeichnung einer Tonspur verzichtete. Das so entstandene Bildformat heißt „Super 35“. Vor über hundert Jahren wurde der Kinofilm dann für die Fotografie zweckentfremdet, popularisiert insbesondere durch die Leica der Firma Leitz. Dazu wurde der Filmtransport um 90 Grad gedreht; der Film lief also horizontal durch die Kamera und aus der begrenzten Bildbreite wurde die Bildhöhe von 24 mm. Als Bildbreite setzten sich 36 mm durch, was exakt der Breite von acht Perforationslöchern entsprach. Damit ließen sich präzise Bildzähler konstruieren, die nach acht Löchern auf die nächste Zahl sprangen. Super-35-Bilder sind nur vier Perforationslöcher hoch, das Kleinbildformat also doppelt so groß. Manche Kamerahersteller gingen später zum Format des Kinofilms zurück und nannten es „Halbformat“ – aus der Kleinbildperspektive verständlich, obwohl es ja eigentlich das Urformat Super 35 war.

Wenn das Kleinbild als klein galt, dann im Gegensatz zum früher dominierenden Rollfilm der Typen 120 und 220. Typ 120 war ein Sandwich aus dem eigentlichen Film und einer Papierlage, die beim Typ 220 teilweise wegfiel, so dass auf der Spule mehr Platz für längere Filme blieb. Perforationslöcher hat der Rollfilm nicht, und statt eines mechanischen Bildzählers besitzen die Kameras ein Sichtfenster, hinter dem man die auf dem Papier aufgedruckten Bildnummern ablesen kann.
Zwischen Kleinbild und Mittelformat stand früher der Typ-127-Rollfilm mit einer Breite von 46 mm, wie ihn unter anderem die Baby Rolleiflex verwendete. Die Bilder hatten eine Höhe von rund 4 Zentimetern und Breiten von 3, 4 oder 6,5 Zentimetern. Besonders populär war für einige Zeit das Format 4 × 4, weil sich solche Superslides noch mit handelsüblichen Kleinbild-Diaprojektoren vorführen ließen. Der Kleinbildfilm lief dem Typ 127 aber schließlich den Rang ab, und 1995 stellte Kodak, die diesen Film einst erfunden hatten, die Produktion ein.
Filmmaterial in früher gängigen Größen zu bekommen, ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach wie noch vor 20 Jahren, und selbst bei den beliebtesten Varianten ist die Auswahl beschränkt. Die alten Formate leben aber in der digitalen Fotografie weiter. Das gilt natürlich für das Kleinbild- oder Vollformat, aber auch für viele andere. Selbst das 4 × 4-Format des längst vergessenen Typ-127-Rollfilms feierte eine digitale Wiedergeburt, nämlich unter anderem in Hasselblads CFV-Digitalrückteil, dessen Sensor eine lichtempfindliche Fläche von 37 mm × 37 mm hat, was annähernd dem analogen Filmformat entspricht.

Das Niemandsland zwischen Kleinbild und Mittelformat hatte auch nach dem Ende des Typ-127-Rollfilms seine Anziehungskraft nie verloren. Der Kleinbildfilm besaß noch immer die Perforationslöcher des Kinofilms, die für den Filmtransport aber durchaus verzichtbar waren – man konnte den Film auch allein mit der Aufwickelspule durch die Kamera ziehen, ohne dass Zahnräder in gestanzte Löcher greifen mussten. In den 80er Jahren gab es deshalb Überlegungen, ein größeres Kleinbildformat ohne Perforation zu entwickeln, das eigentlich schon ein Mittelformat gewesen wäre. Ohne die Löcher hätte man fast die gesamte Filmhöhe von 35 mm für die Bildhöhe nutzen können, und es wäre ein ähnliches Bildformat entstanden, wie es heute in der digitalen Mittelformatfotografie verbreitet ist: 43,8 mm × 32,9 mm. Das ist zwar deutlich kleiner als die Mittelformate, wie man sie von den Rollfilmen der Typen 120 und 220 kennt, aber in der Digitalfotografie jenseits des Kleinbilds ist es mittlerweile das dominierende Bildformat. Es bietet einerseits 60 Prozent mehr Fläche als das Kleinbild, macht die Kameras aber nur moderat größer – Höhe und Breite der Sensoren wachsen um 37 beziehungsweise 22 Prozent. Vor allem ist dieses kleine Mittelformat noch halbwegs erschwinglich.
In der analogen Fotografie mussten wir damals auf ein solches Format zwischen klassischem Kleinbild und klassischem Mittelformat verzichten. Auch wenn es lediglich eine Modifikation des Kleinbildfilms erfordert hätte, wären in den Kameras größere Einstellscheiben und Prismen nötig geworden, und die Objektive hätten einen größeren Bildkreis mit hoher Kontrastübertragung ausleuchten müssen. Letztendlich wäre es auf einen vollständigen Neukauf der Fotoausrüstung hinausgelaufen, wozu weder Profis noch ambitionierte Amateurfotografen große Lust verspürten, den Verlockungen eines größeren Bildformats zum Trotz.
So einigten sich die größten Kamera- und Filmhersteller zwar 1996 auf einen neuen Film ohne Perforationslöcher, aber statt eines größeren Super-Kleinbilds war es das Advanced Photo System (APS), das nicht qualitätsbewusste Kleinbildfotografen, sondern vor allem Einsteiger in die Fotografie ansprechen sollte. APS-Kameras (weit überwiegend waren es Kompaktkameras) boten die Wahl zwischen drei Formaten, die alle deutlich kleiner als das Kleinbild waren: APS-C (25,1 mm × 16,7 mm) im Seitenverhältnis 3:2, APS-H (30,2 mm × 16,7 mm) mit dem TV-Seitenverhältnis 16:9 sowie das in der Höhe beschnittene „Panorama“-Format APS-P (30,2 mm × 9,5 mm). Der Verzicht auf eine Perforation schuf Platz für die Speicherung digitaler Daten zu den Bildern, wofür insbesondere eine Magnetspur diente. 80 Kilobyte ließen sich so auf einem Film mit 40 Aufnahmen unterbringen. Damit war die Speicherung von Metadaten schon in der analogen Ära erfunden, wie sie später der Exif-Standard auch für Digitalbilder vorsah. APS-Kameras nutzten die damit gegebenen Möglichkeiten aber nur in begrenztem Maße.
Die Bezeichnungen APS-C und APS-H kennen wir auch als Sensorgrößen, doch sind diese sind nur ganz grob an die analogen APS-Formate angelehnt. Das digitale APS-C (meist 23,5 mm × 15,7 mm und bei Canon-Sensoren noch etwas kleiner) erreicht nicht ganz sein analoges Pendant; APS-H-Sensoren haben ein Seitenverhältnis von von 3:2 (wie beim Kleinbild- und APS-C-Format) statt 16:9. Das Format der sogenannten APS-C-Sensoren könnte man ebenso gut auch als digitales Halbformat oder, in der Terminologie des Kinofilms, Super 35 bezeichnen.
Eine weitere Entsprechung analoger und digitaler Bildformate ist sicherlich Zufall: Four Thirds und das gleich große Micro Four Thirds haben praktisch dieselben Dimensionen wie das Bildformat des Pocketfilms (Typ 110): 17 mm × 13 mm. Immerhin ist es deshalb möglich, die Wechselobjektive von Pentax’ Pocket-Spiegelreflexsystem Auto 110 an MFT-Kameras zu adaptieren.
Nicht nur in der Fotografie geht so manche Technik, die Jüngere nur aus der digitalen Ära kennen, auf analoge Vorbilder zurück. Das scheinbar widersinnig benannte Schärfungsverfahren der „Unscharfmaskierung“ beispielsweise: In der Dunkelkammer kopierte man früher ein nicht hinreichend scharfes Negativ zu einem unterbelichteten (und daher zu hellen) und leicht unscharfen Positiv. Das Negativ und die positive „Maske“ kombinierte man dann zu einem Sandwich, und dessen Vergrößerung ergab ein nachgeschärftes Bild mit hervorgehobenen Konturen. Die digitale Version der Unscharfmaskierung tut prinzipiell dasselbe, indem sie eine weichgezeichnete Kopie des Bildes erzeugt und deren Pixelwerte dann von denen des Originals abzieht.
Auch das Verfahren des „Abwedelns und Nachbelichtens“ (englisch „dodge and burn“) ist eigentlich eine Dunkelkammertechnik, um große Kontraste im Bild zu verringern, ohne auf eine weiche Gradation des Fotopapiers ausweichen zu müssen, was zu eher flauen Ergebnissen geführt hätte: Man schnitt sich aus Pappe eine Maske zurecht, um beim Vergrößern während eines Teils der Belichtungszeit das Licht zurückzuhalten; dabei bewegte man die Maske leicht hin und her, damit keine harten Konturen entstanden. Das war das „Abwedeln“, mit dem man zu dunkle Teile des Bildes aufhellte – oft auch ohne Maske, sondern nur mit den Händen. Das „Nachbelichten“ funktionierte genauso, nur dass man mit einer Maske nun einem Teil des Fotopapiers zusätzliches Licht spendierte, womit diese Bildbereiche weiter abgedunkelt wurden.
Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.