Der Museumsbesucher als kleines Kind betrachtet
Dass es mich stört, wenn Ausstellungskuratoren Besucher vor jeder theoretisch denkbaren Irritation schützen wollen, hatte ich hier bereits erwähnt. Letztes Wochenende war es erneut die Hamburger Kunsthalle, die sich unnötige Sorgen um die seelische Stabilität ihrer Gäste machte.
Wenngleich Hamburg keine so angesagte Destination wie Venedig oder Barcelona ist, ist die Stadt doch rappelvoll mit Touristen. Ich weiß ja nicht, was Hamburg-Touristen gewöhnlich reizt (der Elbstrand ist schön, aber das Baden in der Elbe lebensgefährlich), doch für Kulturinteressierte ist die Stadt auch im Hochsommer attraktiv. Während die Elbphilharmonie noch Pause macht, lockt das Kampnagel Sommerfestival mit Tanz, Theater, Performances und Konzerten noch bis zum 25. August. (Tipp: Die Veranstaltungen im lauschigen Avant-Garten sind kostenlos.)



Im Bucerius Kunst Forum ist noch bis zum 22. September das schwarzweiße Werk von Henri Cartier-Bresson (1908–2004) ausgestellt; jedermanns Lieblingsfoto des Meisters ist dabei und noch viel mehr, das man vielleicht noch nicht kannte. Die Flexibilität der Ausstellungsfläche, die sich mit Trennwänden immer neu aufteilen lässt, führte diesmal dazu, dass wir uns immer wieder fragten, ob wir wirklich schon alles gesehen hatten – im Zweifelsfall hatten wir noch irgendeine Schaffensperiode Cartier-Bressons übersehen. Oder wie die Ausstellung treffend betitelt ist: „Watch! Watch! Watch!“

In der Kunsthalle, wo wir zuletzt die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung besucht hatten, wollten wir diesmal in William Blakes Universum reisen (noch bis zum 8. September). Der britische Dichter und Zeichner William Blake (1757–1827) musste selbst für englische Verhältnisse als exzentrisch gelten, aber die Briten lieben ihn dafür; die Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall sind nicht beendet, ohne dass alle Blakes Jerusalem singen. Jedes Schulkind kennt sein Gedicht vom Tiger: „Tyger Tyger, burning bright, / In the forests of the night“. In Deutschland ist er weniger bekannt, aber meine Begleiterin hatte lange Zeit in London gelebt und auch mir war Blakes Werk geläufig; zumindest kannte ich seine von ihm selbst illustrierte Gedichtsammlung Songs of Innocence and Experience (und bei der Übertragung der Last Night of the Proms hatte ich Jerusalem schon immer mitgesungen).

Die Kuratoren der Ausstellung, die Blakes Werk das seiner deutschen Zeitgenossen Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge gegenüber stellt, machten sich mal wieder viel zu viele Sorgen über die Besucher, die an diesem oder jenem Anstoß nehmen könnten. William Blake hatte eine Privatmythologie entwickelt, die sich durch seine Werke zieht, ganz ähnlich wie es später J. R. R. Tolkien im Herrn der Ringe und dem Silmarillion getan hat, und ein durchaus nützliches Glossar sollte darin einführen. Aber war der Hinweis zu den Geschlechterbildern wirklich nötig?
Die Eigenschaften der allegorischen Figuren in Blakes Mythologie orientieren sich an Vorstellungen des Männlichen und Weiblichen, die aus heutiger Perspektive mindestens stereotyp oder sogar sexistisch und misogyn erscheinen. (…) Blakes Allegorien weisen in seinen mythischen Welten stets auch zeitgenössische Variationen des historisch gewordenen binären Geschlechtersystem auf.

William Blake segelte im 18. Jahrhundert weitab vom damaligen Mainstream des Geisteslebens, doch die Vorstellung von zwei Geschlechtern hatte er nicht aufgegeben und von 100+ Genderrollen wusste er nichts. Trotzdem: Misogyn war er gewiss nicht. Muss man ernsthaft darauf hinweisen, dass man im 18. Jahrhundert die Menschheit in Männer und Frauen aufteilte und gewisse konventionelle Vorstellungen von den Eigenschaften dieser Geschlechter pflegte, worin auch Blake befangen war?
Im Glossar wird Blakes allegorische Figur Albion als „die männlich gelesene Personifikation Englands“ beschrieben, aber man könnte auch einfach sagen, dass sich Blake Albion als Mann vorgestellt hatte. Als weißen Mann, wie von den Kuratoren vorwurfsvoll angemerkt wird, wobei das für eine Verkörperung des damaligen England nur natürlich erscheint.
Völlig absurd wurde es dann bei einer Vitrine, die mit Stoffbahnen verdeckt war; nur wer sich seelisch hinreichend gefestigt fühlte, sollte nachschauen, was sich darunter verbarg. Es ging konkret um Blakes Illustrationen in einem Buch von John Gabriel Stedman, einem Soldaten, der Teil der kolonialen Herrschaft in Surinam gewesen war:
Die Abbildungen in dieser Vitrine sind verdeckt, da sie rassistische Darstellungen beinhalten, die sich gegen Schwarze Menschen richten. Wir haben sie aus diesem Grund nicht direkt sichtbar gemacht, aber der Stoff kann angehoben werden, um sie zu betrachten.
Nachdem wir die Stoffbahnen angehoben hatte, fragten wir uns, was es denn nun wert gewesen wäre, verborgen zu bleiben. Blakes Darstellungen von Afrika, Europa und Amerika waren aus allegorischer Absicht stereotyp, aber nicht offensichtlich gegen irgendjemanden gerichtet. Verdeckt war auch die Zeichnung einer Gruppe gefesselter afrikanischer Sklaven, die von einem eine Peitsche schwingenden Weißen angetrieben wurde. So beklagenswert es ist, aber Sklaverei war damals eine Realität und William Blake bildete sie ab. Was wäre damit gewonnen, wenn man diese historische Realität verbergen würde? Kolonialismus wird ja nicht wirksam bekämpft, indem man ihn verleugnet.

Stedmans Text verteidigte die Institution der Sklaverei und rechtfertigte den Kolonialismus, worauf die Ausstellungsmacher zu recht hinweisen, aber er beschrieb auch die exzessive und willkürliche Grausamkeit der Europäer und weckte Mitleid mit den Sklaven. Abolitionisten, die auf eine Abschaffung der Sklaverei drängten, beriefen sich daher ausdrücklich auf ihn. Stedmans Position war in sich widersprüchlich; theoretisch befürwortete er die Sklaverei, fühlte sich dann aber in der Praxis von ihr abgestoßen. William Blake selbst wiederum kann kaum als Apologet der Sklaverei gelten.
Trotz der erwähnten Seltsamkeiten ist die Ausstellung William Blakes Universum sehenswert; eine so umfangreiche Übersicht von Blakes Werk im Kontext seiner Zeit wird man so schnell nicht anderswo sehen.

Wir verließen kurz den Altbau der Kunsthalle, weil die Premiere von Trisha Browns Man Walking Down the Side of a Building angekündigt war – dafür war schon am Abend vorher geworben worden, als wir auf Kampnagel Lucinda Childs Choreographien Four New Works gesehen hatten. Seltsamerweise unterblieb ein Hinweis der Art „Don’t try this at home“, bevor Trisha Brown ganz lässig die Fassade der Galerie der Gegenwart herunter spazierte. Dabei warnt die Kunsthalle sogar vor der Höhe von Stufen, die – da es sich um Kunst handelt –, nicht den üblichen Standards entsprechen:

Und dann auch das noch: Musste ich mir als altem weißen Mann nicht selbst den Vorwurf kultureller Aneignung machen, da ich zu dieser Gelegenheit ein Outfit eines nigerianischen Modedesigners trug? Man weiß es nicht, und mir war’s letztendlich auch egal.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

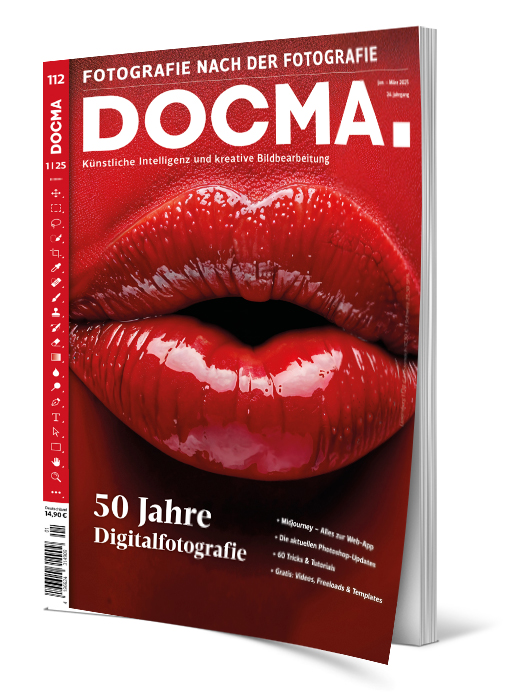





einfach nur wunderbar, wie alles, was Sie schreiben.
Diese Infantilisierung ist nicht nur im Bereich der Kunst oder bei der „Erwachsenenbildung“ zu beobachten!
Sie setzt schon im Kindesalter an:
Sonntagmorgen, Frühstück. Aus nostalgischer Gewohnheit und wegen der meist ausgezeichneten Sachgeschichten läuft „Die Sendung mit der Maus“ im Hintergrund.
Diesmal ein Beitrag über Krebse.
Irgendwann sagt meine Frau: „Halten die alle Kinder für minderbemittelt? – Der Sprecher sagt jetzt zum zwanzigsten Mal, dass Krebse seitwärts laufen. Einmal hätte gereicht, oder?“
Das gibt mir sehr zu denken…
Wobei der Beitrag über die Krebse doch ganz interessant war; ich hatte mir über die Gelenke der Krebsbeine bisher nicht viel Gedanken gemacht. Oder darüber, dass ihre Fortbewegung eigentlich für das Leben im flachen Wasser optimiert ist und sich nur in zweiter Linie auch halbwegs dazu eignet, über den Strand oder den Wattboden zu laufen.
Ahh, noch ein Fan… 😉
Stimmt. Aber diese permanente Wiederholung derselben Aussage erinnerte mich schon ein wenig an US-Pseudo-Dokumentationen-da werden allerdings oftmals ganze Szenen wiederholt.
Ich habe diesen Artikel mit Intresse gelesen,da schüttelt es mich was in dieser Austellung den Besucher zugemutet
wird,wie überhaubt die sogenannten Woken hier versuchen die allgemeine Lebensart der Menschen zu beeinflußen.
Leider sind alle Medien große Unterstützer dieser Minderheit.
defistel