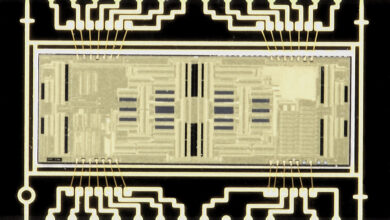Jenseits der Zentralperspektive
Doc Baumann muss jetzt ganz stark sein: Der Maler und Fotograf David Hockney schickt sich an, die in der Renaissance wiederentdeckte und seit Jahrhunderten nahezu unangefochtene Zentralperspektive zu überwinden. Eine Wanderausstellung seiner neuesten Arbeiten im Grenzbereich zwischen Fotografie und Malerei zeigt Werke, mit denen sich problemlos mehrere Bildkritik-Artikel bestreiten ließen. Was hat er sich nur dabei gedacht?
Wie kaum ein anderer zeitgenössischer Maler hat der Brite David Hockney, der vor zwei Wochen seinen 78. Geburtstag feierte, die Fotografie als Inspirationsquelle für die Malerei genutzt und umgekehrt seine als Maler entwickelten Ideen mit fotografischen Mitteln umgesetzt. Sein Interesse an optischen Verfahren ließ ihn zusammen mit dem Physiker Charles M. Falco die Hockney-Falco-Theorie entwickeln, nach der schon die Maler der Renaissance optische Hilfsmittel wie die Camera obscura, die Camera lucida und auch Hohlspiegel genutzt hatten, um ihre dreidimensionalen Motive perspektivisch korrekt auf die Leinwand zu bannen. Kunsthistoriker, die das fälschlich als Vorwurf der Mogelei verstanden, haben diese in David Hockneys „Geheimes Wissen“ (2001 im Knesebeck Verlag erschienen, inzwischen aber leider vergriffen) ausführlich dokumentierte Theorie zurückgewiesen, obwohl tatsächlich manches für sie spricht – ein definitiver Beweis steht allerdings aus.
Während optische Hilfsmittel in Hockneys Sicht Künstlern wie Brunelleschi im 15. Jahrhundert erlaubten, Bilder mit einer perfekten Zentralperspektive zu zeichnen, also so, wie sie auch eine Kamera erzeugt, sieht Hockney in dieser zentralperspektivischen Abbildung mit einem einzigen Fluchtpunkt ein Problem. Die Zentralperspektive rückt das Motiv in den Hintergrund; sie distanziert uns vom Motiv. Hockney will nun diese Distanz eliminieren und damit den Betrachter in die Welt des Bildes versetzen. Wie muss man sich das vorstellen?


Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Objektive unterschiedlicher Brennweiten jeweils eine bestimmte perspektivische Wirkung erzeugten. Ich habe in meinen DOCMA-Artikeln mehrfach darauf hingewiesen, dass es allein die Entfernung und nicht die Brennweite ist, die die Perspektive bestimmt. Wenn ich eine Person mit einem Weitwinkelobjektiv formatfüllend abbilden will, muss ich nahe heran gehen, und diese kurze Distanz erzeugt die vermeintlich weitwinkel-typische Perspektive. Setze ich dasselbe Objektiv aber ein, um eine größere Gruppe von Menschen abzubilden, muss ich zwangsläufig weiter zurücktreten, und würde ich ein so aufgenommenes Bild auf einzelne Personen beschneiden, ergäbe sich eine Abbildung, für die ich aus dieser Entfernung ein Teleobjektiv gebraucht hätte. Genau so sehen die Bilder auch aus – trotz des Weitwinkelobjektivs erscheinen alle abgebildeten Personen für sich genommen in einer „Teleperspektive“.
Nehmen wir an, wir wären auf einer Party und würden mal mit dem einen, mal mit dem anderen Gast plaudern. Jeden einzelnen Gast würden wir aus kurzer Entfernung und damit aus einer „Weitwinkelperspektive“ sehen, und das würde unseren Eindruck prägen. Eine Weitwinkelaufnahme könnte diesen Eindruck freilich nicht wiedergeben – um alle Partygäste abzubilden, müssten wir einen großen Abstand halten und das Ergebnis wäre eine Tele-, keine Weitwinkelperspektive. Hockney hat auf Basis dieser Intuition versucht, den Eindruck eines Partygastes in ein Bild zu übersetzen, das naturgemäß eine Montage sein muss. Er hat jede einzelne Person (wie auch alle Hintergrundmotive) mit einem Objektiv kurzer Brennweite aus kurzer Distanz fotografiert und diese Einzelbilder zu einem Gesamtbild montiert. Eine vorausgehende malerische Umsetzung solcher Motive unterstützte ihn bei der Umsetzung dieser Idee – seine Bilder (Fotos ebenso wie Gemälde) sind derzeit noch bis zum 19. September 2015 in der Galerie L.A. Louver im kalifornischen Venice ausgestellt.
Da das fertige Bild eine Vielzahl von Aufnahmen aus unterschiedlichen Standpunkten vereinigt, gibt es keinen gemeinsamen Fluchtpunkt mehr; vielmehr hat jedes Einzelbild seinen eigenen Fluchtpunkt. Diese – technisch gesehen – falsche Abbildung hat die Eigenheit, den Betrachter in die Szene hinein zu ziehen – eben in die Entfernung, aus der der Fotograf tatsächlich fotografiert hatte. Das Bild wirkt ohne irgendwelche Hilfsmittel dreidimensional. (Auf YouTube hat Hockney dieses Konzept und andere Aspekte seiner Arbeit ausführlich erklärt.)
Hockneys Idee ist zweifellos kein Allheilmittel und ihre Umsetzung längst nicht für jede fotografische Aufgabe empfehlenswert, aber sein Ansatz zeigt, dass die Zentralperspektive weder der einzige noch der in jedem Fall beste Weg ist, Bilder zu erzeugen, die den Eindruck unserer eigenen Augen wiedergeben – was ja letztendlich der Maßstab für die Güte einer Abbildung ist. Aber damit keine Zweifel aufkommen: Nichts spricht dafür, dass sich die notorischen Anwärter auf unseren Bad Pixel Award ähnliche Gedanken wie David Hockney machten – oder überhaupt irgendwelche Gedanken, was das betrifft.
Auf solche Fragen der Perspektive werde ich auch in meinem Artikel „Räumlichkeit in zwei Dimensionen“ in der DOCMA 66 eingehen, in dem darum geht, wie Brennweite und Blende die Abbildung einer dreidimensionalen Realität in einem zweidimensionalen Bild beeinflussen.