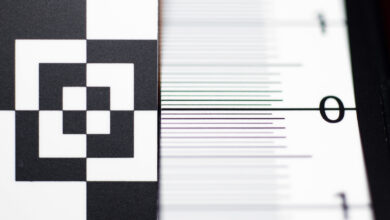Zooms vs. Festbrennweiten
Im Laufe der letzten rund 40 Jahre sind Zoom-Objektive zur fotografischen Normalausstattung geworden. Viele Käufer von Systemkameras ziehen Festbrennweiten kaum noch in die engere Wahl, sondern versuchen, alle interessanten Brennweiten mit zwei oder besser noch einem einzigen Zoom abzudecken. Die Debatten über die Vor- und Nachteile beider Konzepte dauern dennoch bis heute an.

Bei manchen Fotografen der alten Schule stehen Zoom-Fans in einem ähnlichen Ruf wie Fahrer von E-Bikes. Die erreichen dasselbe Ziel wie die Radfahrer, die sich mühsam abstrampeln, bloß entspannter und weniger nass geschwitzt. Aber der elektrische Hilfsmotor gilt eben doch als Schummelei.
Mit aktuellen Zooms geht man zwar nicht mehr wie ehedem große Kompromisse ein, denn ihre Abbildungsleistungen können sich durchaus sehen lassen; nur wenn es um die höchste Lichtstärke geht, sind Festbrennweiten noch immer unerreicht. Aber, so der nagende Verdacht der Festbrennweitenfraktion, verliert man nicht doch etwas, wenn man sich die Wahl der Brennweite und des Bildausschnitts so bequem macht? Dahinter mag die Philosophie stehen, dass sich mit harter Arbeit abzumühen ein Wert an sich sei – eine Idee, die mir durchaus fremd ist, denn als bekennender Epikureer habe ich es gerne bequem. Unabhängig davon kann man aber auch ganz unideologisch und mit rein fotografischen Gründen für Festbrennweiten argumentieren. Aber zunächst erscheint mir eine Ehrenrettung der Zoom-Fotografie angebracht.
Wenn jemand sein Motiv im Sucher anvisiert und mit dem Zoomring den Bildausschnitt wählt, mäkeln die Zoom-Verächter, er sei nur zu faul zum Laufen. Entsprechend hat sich der Ausdruck „Turnschuh-Zoom“ für die Alternative eingebürgert, stattdessen näher an das Motiv heran oder im Gegenteil weiter zurück zu gehen, bis der Sucher den gewünschten Bildausschnitt zeigt. Hier liegt allerdings ein Denkfehler vor, denn im Gegensatz zum Zoomring ändert die Wahl eines anderen Aufnahmestandpunkts die Perspektive, und so kann das eine kein Ersatz für das andere sein.
Tatsächlich ist es durchaus sinnvoll, zunächst einmal den am besten erscheinenden Aufnahmestandpunkt zu suchen, um von dort aus nur noch den Bildausschnitt per Zoom festzulegen. Aber seien wir ehrlich: Oft genug passiert es, dass wir uns gar keine großen Gedanken über den optimalen Standpunkt machen, sondern einfach von dem Punkt aus fotografieren, an dem wir das Motiv entdeckt haben – was dann den Kritikern recht gäbe.

Dafür muss nicht unbedingt Faulheit verantwortlich sein. Zum einen sind manche Motive flüchtig; wer dann nicht schnell genug auf den Auslöser drückt, kommt zu spät. Zum anderen sind Amateurfotografen oft nicht allein unterwegs, sondern müssen sich gegenüber Partnern und/oder Kindern rechtfertigen, wenn sie vermeintliche Ewigkeiten um Motive herum schleichen, deren Reiz sich den Begleitern von vornherein nicht erschloss. Da erscheint es ratsam, für die Aufnahmen nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Für dieses Problem gibt es naturgemäß keine technische Lösung. Wenn man seine Lieben nicht für die eigenen Interessen begeistern kann – ich finde ja, dass Beziehungen unter keinem guten Stern stehen, in denen man nicht zumindest Verständnis für die Leidenschaften des Partners aufbringt –, sollte man sich für Fotoprojekte besser kurze Auszeiten von der Familie nehmen.
Wie auch immer man es einrichtet: Das Bild, das einem vorschwebt, bekommt man nur, wenn man sich genug Zeit für die Wahl des Aufnahmestandpunkts nimmt. Ob man mit Zooms oder Festbrennweiten fotografiert, spielt dafür erst einmal keine Rolle. Aber man kann die Sache auch ganz anders als oben beschrieben angehen, und damit gewinnen die Festbrennweiten an Reiz.
Letzte Woche hatte ich erklärt, weshalb man Objektiven einer bestimmten Brennweite zumindest als Faustregel eine bestimmte Perspektive zuschreiben kann. Die Perspektive wird zwar vom Aufnahmestandpunkt und damit der Entfernung bestimmt, nicht von der Brennweite, aber da die typischerweise gewählte Aufnahmedistanz von der Größe des Motivs abhängt, zeigt sich in der fotografischen Praxis doch meist ein solcher Zusammenhang. Fangen wir also mal vom anderen Ende her an und überlegen uns, wie wir unsere Motive abbilden wollen. Je nach der Brennweite ergeben sich andere Bildwirkungen: Die Motive wirken unterschiedlich plastisch, die Bedeutung des Hintergrunds ändert sich, und vor allem ändert sich mit der Brennweite auch der einzunehmende Standpunkt, an den wir dann ja auch den Betrachter unseres Fotos versetzen. Eine Aufnahme aus nächster Nähe erzielt eine ganz andere Wirkung als eine aus der Distanz, selbst wenn das Motiv jeweils gleich groß abgebildet wird.
Wir entwickeln also zunächst eine Vorstellung davon, was für eine Bildwirkung wir anstreben, und wählen daraufhin die entsprechende Brennweite. Bevor uns das zwanglos gelingt, müssen wir die Wirkung verschiedener Brennweiten in der Praxis kennenlernen, und das gelingt am besten, wenn wir uns auf wenige Objektive mit fester Brennweite beschränken. Ein, zwei oder maximal drei Objektive in der Fototasche genügen; mehr wären kontraproduktiv und würden den Lerneffekt schmälern. Wenn wir uns dann mit einem Motiv auseinandersetzen, wechseln wir nicht etwa alle Brennweiten durch. Dafür wäre ein Zoom viel besser geeignet, und wir wollen uns die Sache ja nicht schwerer als nötig machen – schließlich ist dies keine Bußübung. Da wir uns für eine bestimmte Bildwirkung und Perspektive entschieden haben, steht die Brennweite aber von vornherein fest, und so müssen wir nur noch den Aufnahmestandpunkt finden, aus dem sich das Motiv von seiner interessantesten Seite und im gewünschten Bildausschnitt zeigt. Übrigens kann, wer sich auf eine (kurze) Brennweite beschränken will, natürlich auch zu einer Kompaktkamera wie der Fuji X100V, der Leica Q (2) oder der Ricoh GR III greifen.

So könnte man sich das Zoomen vollständig abgewöhnen, denn feine Brennweitenabstufungen sind bei dieser Vorgehensweise überflüssig – ein Millimeter mehr oder weniger macht für die Bildwirkung keinen signifikanten Unterschied. Trotzdem bleiben Zooms relevant, denn die beschriebene Methode ist nicht immer anwendbar. Manchmal können wir den Aufnahmestandpunkt gar nicht frei wählen, etwa wenn wir bei einer Fotosafari aus dem sicheren Geländewagen fotografieren und zwangsläufig zum Telezoom greifen. Ein Löwenporträt aus nächster Nähe wäre beeindruckend, aber nicht ratsam. Sportfotografen würden ungleich lebendigere Fotos von Fußballspielen gelingen, wenn sie sich wie der Schiedsrichter frei auf dem Spielfeld und immer auf Ballhöhe bewegen könnten, aber auch das ist leider nicht realisierbar. Umgekehrt hilft bei Innenaufnahmen oft nur eine sehr kurze Brennweite, weil uns mit der Wand im Rücken größere Aufnahmedistanzen verwehrt sind.
Damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt: Zooms sind durchaus keine Wundermittel, um durch die stufenlose Brennweitenwahl vom Weitwinkel- bis in den Telebereich unsere Gestaltungsfreiheit zu erweitern. Ganz im Gegenteil sind sie das Mittel der Wahl, wenn unsere Gestaltungsfreiheit so oder so eng begrenzt ist. Haben wir aber diese Wahl – und dazu die Zeit, um die beste Wahl zu treffen –, dann sind sie im Grunde überflüssig. Wichtiger als ein großer Objektivpark und große Zoombereiche ist es, unsere Aufnahmen im Kopf vorausplanen zu können, so dass wir von Anfang an wissen, welche Brennweite wir brauchen. Das setzt viel Erfahrung voraus, und diese Erfahrung gewinnen wir, indem wir öfter mal mit einer kleinen Zahl von Festbrennweiten losziehen.